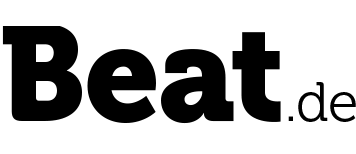Der Trend geht zur Zweitverwertung: Innerhalb bestimmter Stilrichtungen klingen viele Songs wie identische Kopien. Das klingt nach einer Hiobsbotschaft – könnte aber in Wahrheit auch seine Vorzüge haben.

Auf Sendern wie dem wiederbelebten MTV und Deluxe Music haben sich bis heute Programme gehalten, in denen ausschließlich Musik aus Deutschland gespielt wird. Vor kurzem blieb ich auf einer dieser Sendungen hängen. Ein Song, der mir auffiel, war „Next“ von Ufo361 featuring RIN. Zum einen, weil er ziemlich großartig produziert war. Zum anderen, weil er bis auf die Sprache der Raps in keinem Takt seine Herkunft verriet. Alles daran, von dem Beat und den Sounds über den Flow und die Melodie bis hin zu den unzähligen kleinen genretypischen Licks, klang exakt so wie bei den internationalen Vorbildern.
Verwundern kann das nicht, wurde „Next“ doch von dem Kanadier Shane Lee Lindstrom alias Murda Beatz produziert, der bereits mit Cardi B und Niki Minaj zusammengearbeitet und mit Drake's „Nice for what“ einen weltweiten Nummer-1-Hit geschrieben hat. Dass angesagte Muster kopiert und neu aufbereitet werden, ist zwar kaum eine Meldung wert. Doch ist Ufo361 keineswegs ein Einzel-, sondern vielmehr der Regelfall. In manchen Genres hat man gelegentlich das Gefühl, als höre man nichts als endlose Remixe des selben Songs. Das Imitat galt früher gemeinhin als der schlimmste Vorwurf schlechthin. Heute ist es zum Ritterschlag geworden.
Nicht nur ein Vorurteil
Nun ist die Behauptung, dass Charts-Musik immer homogener klingt, nichts wirklich Neues. Man könnte dahinter schlicht das ewige Vorurteil älterer Generationen gegenüber der aktuellen vermuten. Diesmal aber ist tatsächlich ein wenig mehr im Busch. Spezifisch bei Trap und Cloud-Rap ist die Tendenz zur direkten Übernahme besonders ausgeprägt. Denn es werden nicht nur musikalische Elemente wiederverwertet. Auch textlich werden nahezu in jedem Song ausschließlich die selben Themenfelder beackert, ganz spezifische Worte wie Textbausteine in einem Modellkasten mit nur minimalen Veränderungen neu zusammengesetzt.
Allerdings gibt es auch in anderen Genres ähnliche Entwicklungen. Dazu gehören die kreativen Welten, die sich immer wieder um ganz bestimmte Rhythmus-Muster herum bilden. Einer davon ist der sogenannte Triggerman-Beat. Basierend auf einem sekundenkurzen Sample aus der 86er Electro-Hop-Underground-Hymne „Drag Rap“ zieht sich der Groove seit Jahren durch zahllose Produktionen, deren Elemente sich teilweise zum Verwechseln ähnlich sind. Gerade noch landeten die City Girls mit „Twerk“ einen weiteren Hit, der den Triggerman prominent zur Geltung bringt.
Noch eklatanter ist der Dembow-Beat. Was als ein Nischenphänomen begann, entwickelte sich schon bald zum definierenden Kriterium für das Reggaeton-Genre und schließlich zum möglicherweise derzeit bestimmenden Klangelement im globalen Mainstream-Pop. So findet sich der Dembow gleich mehrfach auf Madonnas „Lady X“ und bildete er die rhythmische Basis für geschätzte 70% von Shakiras „El Dorado“. Gleich zwei der größten Youtube-Hits überhaupt basieren auf ihm: Luis Fonsis „Despacito“ und Daddy Yankees „Gasolina“, deren Zugriffsraten in beiden Fällen die Milliardengrenze überschritten haben.
Die so typischen Snaredrumfiguren alleine sind zwar nicht genug, um eine Stilrichtung komplett zu fixieren. Was den Dembow aber von Vorgängern wie dem Amen-Break oder 2-Step unterscheidet, ist, dass er sich sehr oft mit ganz spezifischen Harmonie- und Melodie-Mustern paart, deren genaue Einhaltung von den Produzenten akribisch befolgt wird. So klingen sogar Lieder von einstmals recht eigensinnigen Künstlerinnen wie Madonna und Shakira kein bisschen anders als die übrigen Songs aus den Charts.
Näher zusammen oder weiter auseinander?
Seit 2012 hat es immer wieder verschiedene Studien gegeben, um die Vermutung zu hinterfragen, dass sich Pop-Titel tatsächlich immer ähnlicher werden. In der Tendenz haben diese die Behauptung bestätigt und dabei einige interessante Tatsachen zutage gefördert. Problematisch sind solche Bemühungen natürlich trotzdem. Zum einen, weil die verwendeten Unterscheidungskriterien oftmals fraglich sind. Nur weil sich, wie in einer Untersuchung ermittelt, „Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe“ aktueller Hitparadeneinträge einander annähern, bedeutet das keineswegs, dass die Musik deswegen ähnlicher klingt als vorher.
Vielmehr kann man davon ausgehen, dass moderne Produktionsmethoden in der Summe ganz selbstverständlich dazu geführt haben, dass sich unterschiedliche Genres voneinander eher deutlicher abheben als früher. Innerhalb der individuellen Stilrichtungen aber definieren sich die Musiker immer strenger und längst nicht mehr über die eher allgemein gehaltenen Parameter Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe. Nur, wer die Aufnahmebedingungen bis aufs Itüpfelchen befolgt, darf Teil des Clubs sein, bekommt Marketing-Unterstützung und Medien-Aufmerksamkeit.
Diese mutwillige Engstirnigkeit rechnet sich für Labels und Künstler auch weiterhin. Denn das Publikum hat seinen Hunger nach Gleichklang noch lange nicht verloren. Als Drake mit „Scorpio“ ein Doppelabum vorlegte, mochten die Kritiker und einige wenige Fans sich zwar daran reiben, dass das doch ein wenig arg viel Minuten für im Wesentlichen arg ähnliches Material seien. Das hielt die Platte aber nicht davon ab, sämtliche Streaming-Rekorde zu brechen und mit gleich 25 Songs auf einmal in die amerikanischen Billboard-Charts einzusteigen. Solche modernen Märchen gibt es auch hierzulande.
Der Rapper Capital Bra erreichte zwischen 2017-19 mit einem fulminanten Strom an Singles gleich elf Mal die Spitze der deutschen Charts und stellte damit den unerreichbar geglaubten Rekord der Beatles ein. Dass er dabei zunehmend an Identität verlor, scheint keinen zu stören. Die gleichbleibend euphorischen Reaktionen mögen den in Sibirien geborenen Berliner dazu angestachelt haben, die magische Formel auf seinem neuen Album „CB6“ vollends auf die Spitze zu treiben. „Zu viele gleich klingende Songs“ befand einer der Redakteure der „Backspin“ zum neuen Album „CB6“, aber das ist eine bittere Untertreibung. 18 Tracks sind auf der Scheibe enthalten, davon ähneln sich elf wie ein Ei dem anderen, von den Fake-Marimba-Patterns bis hin zu den austauschbaren Autotune-Lyrics. Es könnte eine Selbstparodie sein, wäre es nicht in Wahrheit ein Erfolgsrezept.
Einfache Erklärungen
Man könnte den beteiligten Produzenten ein mangelndes Berufsethos oder Faulheit vorwerfen. Doch ist die Entwicklung in Wahrheit recht einfach zu erklären. Auf einer ganz praktischen Ebene sind die Kosten für einen Hit gestiegen, die potentiellen Einnahmen aber eher gefallen. So investieren die Verantwortlichen immer häufiger in dieselben, sicheren Produzenten, die damit den Hitparaden intensiver denn je ihren persönlichen Stempel aufdrücken.
Auch erlaubt es die einfache Verfügbarkeit digitaler Produktionsmittel, den Sound eines Musikers weitaus einfacher, schneller und genauer zu kopieren als früher. Im Zeitalter von Youtube-Tutorials und Online-Recording-Akademien gibt es im Wesentlichen keine Geheimnisse mehr. Und weil Tools wie Autotune die Demokratisierungs-, beziehungsweise Amateurisierungstendenzen weiter vorantreiben, nimmt auch die Zahl der Stücke zu, in denen sich neue Artists an den Vorlagen der Großen versuchen.
Aus kreativer Sicht gibt es aber noch weitaus triftigere Gründe. Seit Anbeginn der Charts waren Songwriter stets darum bemüht, sich das aktuell angesagte Vokabular anzueignen. Nach dem unseligen Robin-Thicke-Urteil, welches es nahelegt, dass sogar das Arrangement eines Songs schützenswert ist, besteht große Unsicherheit darüber, wie nahe zwei Lieder überhaupt noch beieinanderliegen dürfen, bevor die Grenze zum Plagiat überschritten wird. Sind Cardi Bs „Money“ und Iggy Azaleas „Sally Walker“ derselbe Song?
Letzterer hat ein paar Pianonoten mehr, aber reicht das für die Eigenständigkeit? Und was ist mit Ed Sheeran? Während sein Song „Photograph“ recht offensichtlich eine identische Kopie des Matt-Cardle-Lieds „Amazing“ ist, liegt der Fall bei einer neuerlichen Klage der Marvin-Gaye-Nachkommen komplizierter. Wie der Experte Rick Beato überzeugend nachgewiesen hat, sind sich die Songs nur produktionstechnisch ähnlich – in der Substanz aber nicht.
Doch traut es inzwischen jeder dem Gericht zu, sich letzten Endes gegen diese musikologische Einsicht zu entscheiden. Auch Sampling ist ein heikles Geschäft geblieben und wird schon lange nicht mehr so freizügig und entspannt betrieben wie noch in den 80ern und 90ern. Nur an Rythmen, Reimflows und Effekten darf man sich auch weiterhin frei bedienen. So suchen Produzenten nun genau dort nach der Möglichkeit, sich in den Zeitgeist einzuklinken, ohne teure Urheberrechtsklagen zu riskieren.
Es mag zunächst einmal naheliegen, in dieser Entwicklung eine Verflachung kultureller Werte zu sehen. Doch sollte man auch eine Lanze für ihre positiven Auswirkungen brechen dürfen. Zum einen sorgt das globale Zusammenrücken dafür, dass die Dominanz der englischen Sprache und amerikanischer Produzenten zumindest ein wenig abgebaut und aufgebrochen wird. Wenn Ufo361 auf „Next“ genau so klingt wie Drake oder Gucci Mane, dann klinkt er sich damit in den internationalen Diskurs ein und wird zum Global Player.
Es hat etwas von einer offenen Revolution, wie sich spanische und lateinamerikanische Produzenten den aus Jamaica stammenden Dembow-Beat zu eigen gemacht, ihn mit Salsa-Elementen gepaart und damit die Führung in der Popmusik übernommen haben. Dabei tragen sie, und das wiederum ist paradox, zumindest stückchenweise ein wenig mehr Vielfalt in die Charts hinein. Davon könnte es schon bald noch mehr geben. Denn die Einhaltung gewisser Regeln erlaubt ironischerweise mehr Experimente als zuvor. Das Moombahton-Genre beispielsweise nimmt den Dembow und macht daraus eine dunkle, langsame Club-Musik. Dass die Ohren der Zuhörer bereits für den Groove sensibilisiert sind, hat eventuelle Berührungsängste für das Neue deutlich reduziert.
Vor allem aber hat die Vereinheitlichung den Effekt, dass immer mehr Musik im Jetzt stattfindet. Statt sich Samples aus den 60ern und 70ern und Songideen aus den 80ern zu schnappen, führt das Imitieren aktueller Songelemente zu einer unvermuteten Rückkehr in eine Echtzeit-Kultur. Klar, die Charts klingen manchmal wie das Mixtape eines einzigen Künstlers. Dafür aber spricht aus ihnen auch eine naive Begeisterung für das, was gerade funktioniert. Sie zeigen auf, was uns verbindet, nicht das, was uns unterscheidet. Das ist nicht immer schön oder besonders anspruchsvoll – der Gedanke aber ist es durchaus.