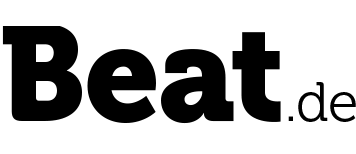Die Musikindustrie hat sich gewandelt, doch das Plagiat ist geblieben. Dabei wird immer deutlicher, dass die Kläger regelmäßig selbst Beklagte waren. Unsere Vorstellung von Originalität wird sich wandeln – und das muss durchaus nichts Schlechtes sein.

Wenn Lana del Rey und Radiohead in einer gemeinsamen Schlagzeile erscheinen, kann das nur zwei Gründe haben: Entweder eine eher ungewöhnliche Kollaboration - oder Ärger. Bei dem Streit um den del-Rey-Song „Get Free“ war es erwartungsgemäß letzteres. Über ihre Anwälte ließ die Band verlautbaren, bei „Get Free“ handele es sich um ein Plagiat ihres Hits „Creep“. Tatsächlich wird jeder, der die beiden Songs unbefangen hört, die Ähnlichkeit unmittelbar bemerken. Und dennoch entbehrt die Angelegenheit nicht einer gewissen Ironie. Denn: „Creep“ selbst war zur Zeit seines Erscheinens Teil eines Plagiatsprozesses. Keine geringeren als Albert Hammond und Mike Hazlewood hatten Thom Yorke und Co damals bezichtigt, Passagen ihres Klassikers „The Air that I Breathe“ kopiert zu haben. Die Übereinstimmungen waren so offensichtlich, dass Radiohead es nicht einmal auf ein Gerichtsverfahren ankommen ließen. Seitdem muss die Formation sich die Rechte an „Creep“ mit den beiden Songwriting-Legenden teilen. Die Absurdität, auf solch einer Basis andere des Copyright-Verstoßes zu bezichtigen, ist eklatant. Es ist aber keineswegs die einzige Absurdität, die sich zum Thema Plagiat anbringen ließe.
Klage über Klage
Fälle wie dieser häufen sich nämlich. Man kann sich gelegentlich nicht des Gefühls erwehren, als werde nahezu jeder mittelgroße Hit der derzeitigen Charts verklagt. Dass man davon nicht immer etwas mitbekommt, liegt lediglich daran, dass sich viele vermeintliche Übeltäter lieber außergerichtlich einigen. Einige aufsehenerregende Beispiele haben es dann aber doch in die Presse geschafft. Sam Smith's „Stay with Me“, 2014 einer der größten Hits des Jahres, wurde bezichtigt, sich bei Tom Pettty's „I Won't Back Down“ bedient zu haben. Robin Thicke's „Blurred Lines“ wurde als ein Plagiat von Marvin Gaye's „Got to Give it Up“ gewertet. Und der schier omnipräsente Ed Sheeran bekommt geradezu täglich Post vom Anwalt, unter anderem für seine Hits „Photograph“ und „Shape of You“. Der von hochkochenden Emotionen und bewusst geschürten Ressentiments geprägte Gaye-Fall ist dabei eher die Ausnahme. Im Allgemeinen sind Plagiatsprozesse so sehr zu einem festen Bestandteil des Tagesgeschäfts verkommen, dass keiner der Beteiligten noch ernsthafte Entrüstung heucheln möchte. So klang Petty's Statement zu seiner Auseinandersetzung mit Smith bemerkenswert versöhnlich: „Meine vielen Jahre als Songwriter haben mir gezeigt, dass so etwas passieren kann“, so Petty, „Meistens fallen einem diese Dinge auf, bevor ein Song das Studio verlässt. Aber in diesem Fall ist es den Beteiligten eben durch die Lappen gegangen. Für mich ist das ein musikalischer Unfall, nicht mehr. In den Zeiten, in denen wir leben, kaum der Rede wert.“
Petty's Einschätzung in allen Ehren – aber Plagiate sind durchaus der Rede wert. Vor allem, weil es dabei um teilweise sehr viel Geld geht. In dieser Hinsicht hat sich leidlich wenig geändert, seit die beiden vielleicht aufsehenerregendsten frühen Fälle vorgebracht wurden, die noch immer als eine gewisse Blaupause der Debatte herhalten müssen. Der erste war „He's so Fine“ von den Chiffons gegen George Harrison's „My Sweet Lord“. Der zweite „Chariots of Fire“ von Vangelis gegen Stavros Logaridis' „City of Violets“. Harrisons Fall war interessant, weil der Ex-Beatle glaubhaft vermitteln konnte, dass er das Lied beim Komponieren nicht bewusst im Kopf gehabt habe. Zahlen musste er letztendlich trotzdem, weil das Chiffons-Stück derart erfolgreich gewesen war, dass man davon ausging, Harrison habe es schlicht „unterbewusst“ internalisiert. Der Vangelis Prozess war weitaus brisanter. Der Elektronik-Großmeister hatte gerade den Oskar für die beste Filmmusik gewonnen und befand sich auf dem zwischenzeitlichen Höhepunkt seiner Karriere. Eine Verurteilung hätte seinem Ruf sicherlich schwer geschadet und seinen Beitrag zu einer seiner größten Hymnen dramatisch entwertet. Aus heutiger Sicht ist der Fall kaum noch vernünftig auf zu arbeiten, weil Logaridis' Stück in der Originalfassung nur sehr schwer zu finden ist. Letzten Endes obsiegte Vangelis und musste sich seinen Ruhm mit niemandem teilen. 30 Jahre später wurde dann um die Musik herum sogar ein erfolgreiches Musical produziert, während Logaridis, der zur Zeit des Prozesses in Griechenland ein Star war, weitestgehend in der Versenkung verschwand.
Einzigartigkeit
Wenn man an Plagiat denkt, denkt man gemeinhin an Diebstahl. Der Begriff wird der Komplexität der Thematik aber nur unzureichend gerecht. Vielmehr geht es darum, die Einzigartigkeit eines Werks zu schützen, ohne den kreativen Prozess unnötig ein zu schränken. Gerade der zweite Teil dieser Aussage ist wichtig. Denn auffällige Ähnlichkeiten zwischen Pop-Songs sind nahezu systemimmanent. In einem Experiment ließen Forscher musikalisch nicht geschulte Probanden über typischen Pop-Akkorden Melodien improvisieren. Nahezu alle Ergebnisse umkreisten die selben Töne. Damit aus diesem Dilemma nicht ein vollkommener Stillstand resultiert, haben sich die Begründer des Urheberrechts auf ein einfache Formel geeinigt: Plagiate liegen nur dann vor, wenn der Song zum einen eine so starke Ähnlichkeit mit einem anderen aufweist, dass ein durchschnittlicher Hörer dies erkennen kann. Bei Ed Sheeran's „Photograph“ ist dies beispielsweise gegeben, der Refrain eine so eklatante Kopie von Matt Cardle's „Amazing“, dass man beim ersten Vergleich kaum glauben mag, dass dies wirklich zwei verschiedene Stücke sein sollen. Das aber ist kaum der Regelfall und so bewegen sich viele Verfahren in einer Grauzone mit einer Menge Deutungs-Spielraum. Zum anderen muss nachgewiesen werden, dass der Beklagte den Song gekannt haben kann. Nur wenn beide Kriterien erfüllt sind, liegt ein Plagiat vor. Wer also einen Song schreibt, der Note für Note mit einem afghanischen Hit aus den 70ern übereinstimmt, hat vergleichsweise gute Karten. Wer aus eigener Kraft Queen's „Bohemian Rapsody“ komponiert, eher ungünstige.
Beide Tatbestände freilich erweisen sich in der Praxis als heikel. Bei „Chariots of Fire“ waren Logaridis und Vangelis schließlich befreundet gewesen, hatte sich gegenseitig neue Ideen vorgespielt und kreativ ausgetauscht. Dass Vangelis die prägnante Melodie vor seinem eigenen Track gekannt haben konnte, stand deswegen nicht wirklich zur Debatte. Doch war der Fall verzwickter. Auf frühen Vangelis-Kompositionen, beispielsweise seinem offiziellen Debüt „Heaven and Hell“, tauchen Elemente des berühmten Themas bereits in einer rudimentären Form auf. Auch live lassen sich Konzerte finden, auf denen er Musik mit Anklängen an seinen Hit gespielt hatte. Diese Aspekte waren aber eher nebensächlich, weil die Jury die beiden Werke schlicht nicht für ähnlich genug befand. Das erscheint aus heutiger Sicht allerdings eher als ein verblüffendes Urteil. Bei Gary Moore's „Still got the Blues“ wiederum ließ sich die Ähnlichkeit zwischen seinem instrumentalen Gitarren-Hook und einer Passage des eher obskuren Krautrock-Stücks „Nordrach“ der Band Jud's Gallery kaum abstreiten. Doch wie wahrscheinlich war es, dass Moore „Nordrach“, das es damals nicht einmal als Ton-Aufnahme gab, tatsächlich gekannt hatte? Kurioserweise und zu seinem Unglück war Moore Mitte der 70er in Deutschland auf Tour. Man befand es für durchaus plausibel, dass er dabei den Titel im Radio oder auf einem Konzert gehört und 13 Jahre später beim Schreiben von „Still got the Blues“ unterbewusst einfließen ließ. Moore wurde zur Zahlung einer Kompensationsleistung verurteilt.
Fogerty vs Fogerty
Wem das bereits als aberwitzig erscheint, der hat bei dem vielleicht aberwitzigsten Plagiatsfall aller Zeiten erst recht wenig zu lachen. Bei Fogerty gegen Fantasy nämlich verklagte der Produzent und Plattenboss Saul Zaentz die Southern-Rock-Legende John Fogerty, sich selbst kopiert zu haben. Diese leicht verrückt anmutende Behauptung war rein rechtlich nicht ganz so abwegig. Fogerty und Santz hatten sich zerstritten und seitdem stand Fogerty bei einem anderem Label unter Vertrag. Bei dem neuen Titel „The Old Man Down the Road“ von Fogerty's Solo-Album „Centerfield“, so argumentierte Santz, handele es sich schlicht um den Song „Run Through the Jungle“, an dem er die Recht besaß. Santz mag kein sonderlich sympathischer Mensch gewesen sein, doch er hatte einen Punkt: Sogar dem Durchschnittshörer wird sofort auffallen, dass die beiden Kompositionen bis auf den Text nahezu absolut identisch sind – vom Riff bis zur Melodie. Trotzdem ging der Plattenmogul leer aus. Experten sehen den Hauptgrund darin, dass das Gericht es Fogerty, wie übrigens auch Vangelis, erlaubte, mit der Klampfe in der Hand seinen Kompositionsprozess zu erklären. Dabei, so der Copyright-Experte Paul Fakler, bestehe immer die Möglichkeit, dass der Künstler schlicht durch eine eigenwillige Performance die Übereinstimmungen verwische und die Unterschiede betone. So auch hier: Man befand der Songwriter habe schlicht einen eigenen Stil – deswegen klinge ein Fogerty-Song eben immer wie ein Fogerty-Song.
Das mutet zunächst ein wenig platt an. Doch weist die Aussage zugleich auf einen wichtigen Punkt hin. Sogar bei George Harrison's „My Sweet Lord“ offenbart sich die volle Nähe zu den Chiffons erst, sobald man die Partitur zu Rate zieht, die Songs auf die gleiche Tonhöhe bringt und das Tempo angleicht. Aber sind es nicht gerade die feinen Details der Darbietung, welche das Besondere eines Songs ausmachen? Lana del Rey's „Get Free“ folgt der Melodie und Harmonik von „Creep“ geradezu akribisch. Aber während ihr Song sich in einer Art betäubtem Traumzustand aufhält und sich textlich darum dreht zum eigenen Künstlerdasein zu stehen, geht es bei „Creep“ um den aufgestauten Wunsch, ein ganz anderer zu sein. Und es ist gar nicht so sehr die Melodie von „Chariots of Fire“, die den Track so groß macht. Es ist die glorreiche Produktion, an der Vangelis wochenlang arbeitete und die seine Version über das eher biedere Handwerk von Logaridis hinaushebt.
Man kann der aktuellen Klagewelle aber auch etwas Positives abgewinnen. Hätten Radiohead den Prozess tatsächlich durchgezogen und gewonnen, besäße „Get Free“ nun 9 Autoren. Diese Liste ließe sich noch deutlich erweitern. Denn genau genommen kopierte „The Air that I Breathe“ seinerseits den Chanson „Aline“ von Christophe, der wiederum ebenfalls des Plagiats bezichtigt wurde. So werden die Songwriting-Credits zu schlangenähnlichen Gebilden, die sich durch die Jahrzehnte ziehen wie ein roter Faden. In letzter Konsequenz wird das leidige Copyright von einem rein kapitalistischen Instrument zu einer philosophischen Weltsicht. Es ist ein seltsam schöner Gedanke, der den kreativen Prozess trefflich beschreibt: Originalität ist ein kollektives Gut. Wir alle stehen auf den Schultern derer, die vor uns gegangen sind und hauchen der selben Flamme immer wieder neues Leben ein.