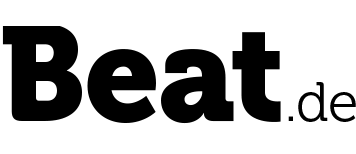In der Politik kämpft die Transgender-Gemeinschaft noch für mehr Rechte. In der Musik hat sie das Ruder bereits an sich gerissen. Im Underground ist ihr Einfluss nicht mehr wegzudenken und immer mehr Trans-Künstler schaffen sogar den Sprung in das Mainstream-Bewusstsein. Für die Betroffenen ist das ein wichtiger Teil ihres Selbstverständnisses. Doch könnte es auch in kreativer Hinsicht spannende Folgen haben.

Eines muss man Interviews mit Kim Petras lassen: Sie sind niemals langweilig. Während andere Pop-Künstler mit größtenteils langweiligen Standard-Themen bombardiert werden – das neue Album, kreative Inspirationen, Fashion-Tipps – geht es bei Petras regelmäßig hart auf hart. „Vermisst du deinen Schwanz?“ hat sie ein Journalist neulich noch gefragt, was sogar der dauer gut gelaunten, selten um Worte verlegenen Ex-Kölnerin die Sprache verschlug. Übel genommen scheint sie es der Musikpresse nicht. Die nämlich ist weniger grundlegend böse denn schlicht unerfahren im Umgang mit Transgendern, Nonbinären, Queeren und Asexuellen – all denen also, die sich mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren können. Die Journalisten werden schnell dazu lernen müssen. Denn kaum eine andere Minderheit kämpft derzeit erbitterter um ihre Rechte als diese - und in wohl keinem Bereich wird dieser Kampf offener ausgetragen als in der Musik.
Dafür gibt es gute Gründe. Der wichtigste ist vielleicht, dass Nichtkonformität und Grauzonen hier schon immer ein natürliches Zuhause hatten. In der Musik geht es geradezu inhärent um das Auflösen von Grenzen – zwischen konkreten Emotionen und abstrakten Klängen, zwischen offener Aussprache und kodierter Andeutung – und so fühlen sich in ihr naturgemäß all diejenigen wohl, die ihre eigenen Grenzen ebenfalls in Frage stellen. Das Frankfurter Zukunftsinstitut hat sogar davon gesprochen, dass „das Fehlen einer eindeutigen Geschlechtszuordnung und vermeintliche sexuelle Devianz“ in der Pop-Industrie inzwischen zum „Erfolgs-Katalysator“ gereichen könne. Das klingt etwas berechnend und verkennt zudem, dass neben einigen tatsächlich erfolgreichen Trans-Künstlern, zu denen neben Kim Petras auch Ahnoni, die ehemalige Sängerin der Kultformation Antony and the Johnsons gehört, der größte Teil der Szene immer noch im tiefsten Underground verwurzelt ist. Was aber stimmt, ist dies: Wer in Geschlechterfragen das Innere nach außen kehrt, darf aktuell darauf vertrauen, auf gespannt gespitzte Ohren zu treffen.
Kein neues Phänomen
Nun wäre es einfach, aber falsch, den Transgender-Einfluss in der Musik als ein neues Phänomen darzustellen. Vielmehr ist das Thema bereits seit langem ein fester Bestandteil des Pop-Diskurses. Bereits die Beatles wurden in ihren frühen Jahren in den Medien oftmals als extrem feminin und un-männlich dargestellt. Frühe Klassiker, die sich mit geschlechtlicher Identität auseinandersetzen, sind Lou Reed's „Walk on the Wild Side“ („Holly came from Miami. (...) Shaved her legs and then he was a she.“) oder „Lola“ von den Kinks („Well I'm not the world's most masculine man / But I know what I am and I'm glad I'm a man / And so is Lola.“) Diese Song leisteten Pionierarbeit und brachten ein Mainstream-Publikum zum ersten Mal in Kontakt mit Charakteren und Gesinnungen, die sie, so Reid selbst, „noch nicht kannten und vielleicht auch nicht kennen wollten.“ [Bockris, Victor (1994). Transformer: The Lou Reed Story. Simon & Schuster. p. 207. ISBN 0-684-80366-6] Zu ihrer Zeit freilich waren sie skandalös und ihre überraschend offene Sprache vermag auch heute noch zu polarisieren, wie Proteste von Trans-Studenten bei einer Party belegen, bei denen „Walk on the Wild“ vor kurzem aufgelegt wurde. Doch handelte es sich bei ihnen noch weitestgehend um Ausnahmen in einem noch immer recht prüden Umfeld. Erst gegen Ende der 70er sollte sich die Thematik vollends einem breiteren Publikum öffnen.
Glam Rock in all seinen Facetten spielte dabei eine maßgebliche Rolle. Allein schon deswegen, weil bereits die Musik selbst einen Grenzgang darstellte: zwischen der aus schwulen Clubs in den Mainstream herübergeschwappten Disco-Bewegung und testosterongeladenem Hard Rock. Noch aufsehenerregender als die Musik aber war die Außendarstellung der zumeist männlichen Sänger, die sich feminin schminkten, die Haare lang wachsen ließen, sich in Federboa und Rüschenhemdchen schmissen und in Falsett oder Opernstimmlage intonierten. Ohne die dazugehörige Mode war Glam Rock oft nicht zu verstehen, weswegen sich bis auf wenige Ausnahmen die Musik bis heute eher weniger gut gehalten hat. Ihr gesellschaftlicher Einfluss aber war epochal, auch wenn es vielen der Beteiligten gar nicht um eine kritische Hinterfragung von Geschlechterklischees gegangen zu sein scheint. Vielmehr war Einiges zurückblickend lediglich Pose und Provokation, diente die augenscheinlich weibliche Inszenierung eher einer Unterstreichung der eigenen Männlichkeit – am deutlichsten sichtbar in den machohaften Exzessen von Bands wie Mötley Crüe oder einem Song wie Aerosmiths „Dude Looks Like a Lady“, der hinter seiner augenzwinkernden Fassade dann doch wieder die olle Kamelle von der strippenden Transe für billige Lacher missbrauchte. Der Unterschied zu David Bowie, bei dem die Androgynität tatsächlich gefühlt war, könnte kaum größer sein.
Geschlechterperspektiven zerfließen
Bowie war ein Wegbereiter, doch spätestens, als die 80er anfingen, spielte der sexuelle Grenzgang in seinem Werk nur noch eine eher untergeordnete Bedeutung. Sein Nachfolger war schnell gefunden: Im Schaffen von Prince zerflossen traditionelle Geschlechterperspektiven vollkommen. Bereits auf den Covern seiner ersten Alben war er stark geschminkt und in Reizunterwäsche zu sehen. Auf einer frühen Tour schockierte er den Funk-Veteranen Rick James mit seiner homoerotischen Bühnenshow, für die er bei manchen Konzerten mit einem Hagel aus Kohlköpfen „belohnt“ wurde. Und in seinen Texten dekonstruierte er das traditionelle Rollenverständnis der heterosexuellen Gesellschaft mit Sätzen wie „I'm not a woman, I'm not a man, I am something that you'll never understand.“ Doch war Prince nicht nur in lyrischer Hinsicht ein wenig weiter als der Rest der Welt. Seine tiefere Bedeutung liegt darin, wie er geradezu visionäre Produktionstechniken nutzte, um seinem Geschlechtsbild im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz eigene Stimme zu verleihen.
Bestes Beispiel: „If I was your Girlfriend“ auf seinem Opus Magnum „Sign "O" The Times“, ein Song, in dem Prince sich vorstellt, als Mann in einer Beziehung die weibliche Rolle zu übernehmen. Über einem hypnotisch schwelenden, Science-Fiction-Funk-Groove schwebt seine Stimme, die, künstlich verfremdet, wie die einer Frau klingt. In Zeiten von Melodyne und Co haben wir uns an diese Form der Vocal-Bearbeitung längst als selbstverständlich gewöhnt. 1987 aber war sie geradezu bahnbrechend. Um so bemerkenswerter, dass „If I was your Girlfriend“ auch im neuen Jahrtausend noch immer futuristisch und faszinierend fremdartig wirkt. Später, so meinen sogar einige seiner größten Fans, verlor auch Prince ein wenig den Faden in diesem Spiel mit klaren Grenzziehungen, verkam die Freizügigkeit zur Formel. Fast zwei Jahrzehnte lang aber gelang ihm der Geniestreich, mit radikalen gesellschaftlichen Tabus die von Konformität geprägten Charts zu dominieren.
Prince hat, deutlicher als fast jeder andere Künstler, einen wichtigen Faktor aufgedeckt, der Pop-Musik so attraktiv macht: Die ständige Umdeutung der eigenen Identität, die hier niemals fix, sondern immer eine Variable ist. Was ist echt und was ist falsch? Wer bin ich überhaupt? Kann ich mich zu der machen, der ich immer sein wollte? Und: Was hält mich davon ab, mein „ich“ zu ändern, je nachdem, wie ich mich gerade fühle oder wohin mich meine Interessen tragen? Es ist die Gegenposition zum Rock, in dem Authentizität – das Bekenntnis zu der uns angeborenen Persönlichkeit mit all ihren Fehlern und Verletzungen – alles ist. Wohl auch deswegen werfen Kritiker Künstlern wie Madonna oder Lady Gaga, die sich im Wochentakt visuell und stilistisch umorientieren, vor, in ihrem selbst erschaffenen Dschungel aus virtuellen Identitäten allmählich den Bezug zur Realität zu verlieren.
Echt unauthentisch / unecht authentisch
Doch tun sie das wirklich? Oder leben sie vielmehr nur ihre vielschichtigen Persönlichkeiten aus? Die experimentelle Produzentin SOPHIE, selbst eine Trans-Frau, auch wenn sie den Begriff nur ungern verwendet, hat darauf hingewiesen, dass alleine schon unsere Vorstellung von „Authentizität“ höchst fragwürdig ist: „Nimm doch als Beispiel die Möglichkeit der Körpererweiterung. Du kannst durch [medizinische] Eingriffe etwas entdecken, das echter ist, als was du jetzt bist.“ Das sogenannte „authentische Ich“ könne etwas sein, was wir uns selbst erschaffen, unter unseren eigenen Bedingungen. Genau das habe sie selbst auch in der Elektronik gefunden, einer Musik, welche die falsche Authentizitätsvorstellung von Gitarren und Schlagzeug im Rock ad absurdum führe. Und zu der wir eine ebenso tiefe, wenn nicht sogar tiefere emotionale Bindung entwickeln können wie zu der vermeintlich „ehrlicheren“ akustischen Musik.
Diese Erkenntnisse sind nicht wirklich neu. Deswegen ist es um so spannender, dass sich der Transgender-Einfluss zunehmend nicht nur in politischen Botschaften ausdrückt, sondern sich ganz direkt in einer innovativen Musik manifestiert. Über die Wirkung des allgegenwärtigen Autotune, bei dem Geschlechterunterschiede verschwimmen, ist an dieser Stelle bereits geschrieben worden. Ganz allgemein ist die Stimme, unser vielleicht persönlichstes Ausdrucksmittel, zunehmend ein Objekt der Manipulation geworden, bei dem Natürlichkeit nichts und Formbarkeit alles ist - das, was Prince bei „If I was your Girlfriend“ kurz andeutete, ist längst zum Allgemeinzustand geworden. Ein gutes Beispiel dafür sind die aus der „Chopped and Screwed“ Tradition entlehnten „Translowmo“ Remixe beliebter Pop-Songs, bei denen das Tempo des Originals um einige bpm nach unten reguliert wird. Weibliche Stimmen gleiten dabei in einen Zwischenbereich zwischen den typischen geschlechtlichen Klangfarben ab. Die Transgender-Journalistin Diana Tourjée hat in einem Artikel darüber berichtet, wie diese primitiv realisierten Remixe simple Pop-Songs plötzlich mit inhaltlicher Bedeutung aufladen.
Irgendwo verbirgt sich inmitten all dieser wohl für alle Beteiligten und Außenstehenden verwirrenden Vielfalt und Veränderung auch ein ganz großer musikalischer Wurf. Den ersten Ansatz dessen, was uns diese Ära der „Transmusikalität“ noch bescheren mag, ist SOPHIE's „Oil of every Pearl's Un-Insides“, ein Album, das mit einer süßlichen, beatlosen EDM-Ballade beginnt und danach in einen Strudel aus industriellem Krach, verzerrten Beats und kybernetisch deformierten Songstrukturen abgleitet. Wer es schafft, sich durch diesen irrwitzigen Strudel zu kämpfen, hat keine Muße mehr, sich über anwesende oder fehlende Geschlechtsorgane Gedanken zu machen.