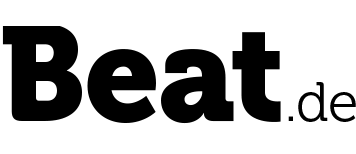Was ist besser: Jede Note veröffentlichen oder jahrelang am nächsten Album feilen? Die Frage treibt Musiker seit Jahrhunderten um, ohne dass sich eine eindeutige Antwort finden ließe. Die Freiheit des digitalen Musikmarkts haben die Polaritäten sogar noch verschärft – und in geradezu absurde Extreme verschoben.

Mit seinem Kentucky-Fried-Chicken-Eimer auf dem Kopf mag Brian Patrick Carroll nicht gerade seriös wirken. In Wahrheit aber nehmen nur wenige ihre Musik so ernst wie er. Unter dem Namen „Buckethead“ hat Carroll 305 Alben veröffentlicht, hinzu kommen verschiedene Nebenprojekte sowie die knapp 50 Scheiben, auf denen er als Bandmitglied oder Gastmusiker vertreten ist. Alleine 2015 erschienen stattliche 118 Buckethead-Alben – mehr als der als extrem produktiv geltende Frank Zappa im Laufe seiner gesamten Karriere zusammengetragen hat. Auf seiner Bandcamp-Seite bietet Carroll die Werke für 2 Euro pro Stück an, kein Preis, der auf ausgeprägte Gewinnabsichten hindeutet. Was also treibt jemanden an, alle drei Tage ein neues Album herauszubringen? Und vor allem: Ist diese Überflutung des Marktes eine sinnvolle Strategie zu einer Zeit, in der der Musikmarkt ohnehin längst als saturiert gilt?
Diese Fragen sind um so spannender, als sich überzeugende Argumente für beide Positionen finden lassen. Selbstverständlich sind dabei die Extrembeispiele die interessantesten. Denn nicht einmal Buckethead ist der produktivste Album-Künstler aller Zeiten. Der japanische Noise-Artist Merzbow alias Masami Akita hat zwar nur unwesentlich mehr Veröffentlichungen auf seinem Konto (ca 350). Doch gehören dazu einige gigantische Box-Sets, darunter die epochale Merzbox, die ganze 50 CDs mit neuem Material umfasst sowie 5 weitere Veröffentlichungen mit 10 oder mehr Scheiben. Doch nicht einmal Akita kommt ansatzweise gegen die ungeschlagene Albumkönigin aller Zeiten an: Schlagersängerin Nana Mouskouri soll über 450 LPs unter eigenem Namen publiziert haben – deren 300 Millionen verkaufte Exemplare sie ganz nebenbei auch zur wohl erfolgreichsten weiblichen Musikerin aller Zeiten machen. Am anderen Ende des Spektrums stehen Künstler, die nur ausgesprochen selten mit neuer Musik an die Öffentlichkeit gehen und teilweise ein geradezu schneckenhaftes Tempo vorlegen. Massive Attack haben 6 Studio-Alben in 28 Jahren aufgenommen, die Soul-Sängerin Sade benötigte für die gleiche Anzahl sogar satte 34 Jahre. Die notorisch langsame Extrem-Metal-Formation Tool braucht durchschnittliche 6,25 Jahre für eine neue Scheibe, das englischen Progressive-House-Projekt Leftfield sogar fast 8. Die unproduktivste Band aller Zeiten aber ist womöglich The Blue Nile. Wenn das Traumpop-Ensemble aus Glasgow tatsächlich noch existiert, hat es für gerade einmal vier Alben 35 Jahre benötigt – eine fast schon stoische Gelassenheit.
Klangliche Momentaufnahme
Befürworter des Schnellschusses verstehen das Album oftmals weniger als ein Statement für die Ewigkeit, sondern eher als eine klangliche Momentaufnahme. Die Grenzen zwischen Studio- und Live-Alben verschwimmen hier oftmals, genauso wie die zwischen Komposition und Improvisation. So sind nahezu alle Merzbow-Tracks in einem Take aufgenommene freie Performances. Und das rapide Wachstum des Buckethead-Katalogs ist vor allem darauf zurückzuführen, dass er über Monate hinweg praktisch jede instrumentale Jam-Session im Studio mitschnitt und anschließend als Album auf den Markt warf. Für den Fan kann das ungemein spannend sein, erlebt man doch die kreative Entwicklung der eigenen Helden nahezu in Echtzeit. Bei Tangerine Dream und Klaus Schulze beispielsweise vollzogen sich in den 70ern und 80ern stilistische Fortschritte schrittweise über mehrere Alben hinweg (was sich bei Schulze auf seinen über 50 CDs umfassenden Archivaufnahmen nachvollziehen lässt). Man kann in diese ausgedehnten Kataloge somit weitaus tiefer eintauchen als in die Diskografie einer Band wie Massive Attack, bei der jedes Album eine Insel mit nur vergleichsweise geringen Berührungspunkten mit den anderen Werken ist. Manche Produzenten erzeugen dieses Gefühl der Grenzenlosigkeit sogar auf der Ebene des einzelnen Albums: Schiller's „Sonne“ umfasste in der Deluxe-Version 28 Tracks, hinzu kam eine geremixte Chillout-Version mit weiteren 14 Titeln. Wenige werden diese Masse an Musik jemals ernsthaft überblicken können – für die wahrhaft leidenschaftlichen Fans freilich bietet sie das Versprechen nahezu unerschöpflichen Hörvergnügens.
Die digitale Revolution hat diese Form der Produktivität einfacher gemacht. Möglich war sie allerdings schon vorher. Bestes Beispiel ist Johann-Sebastian Bach, ein Komponist, dessen Gesamtwerk knapp 170 randvoll gefüllte CDs umfasst, oder sein Kollege Haydn, der unter anderem 108 Symphonien und 68 Streichquartette hinterließ. Für viele der genannten Musiker gibt es schlicht keine Trennung zwischen Probe und Ernstfall, zwischen Leidenschaft und Arbeit, zwischen einem spontanen Einfall und einem fertigen, durcharrangierten Werk. Alles ist gleichermaßen gültig, alles verdient gleichermaßen geteilt zu werden. Der Drang, Dinge fertigzustellen, erhält oberste Priorität. Der kreative Augenblick ist die eigentliche Belohnung, das Ergebnis mal besser, mal schlechter, aber immer ehrlich und originalgetreu. Dem gegenüber steht ein Ansatz, der Musik als die Suche nach Perfektion versteht, als Chance, der scheinbar willkürlichen physischen Welt eine kleine Utopie der kunstvollen Ordnung gegenüberzustellen. Auch, wenn sie zu den langsamsten Bands aller Zeiten gehören, haben Portishead genau das geschafft: Jedes ihrer drei Studio-Alben entwirft eine ganz eigene, unverkennbare Welt, in der jede Note ihren Platz hat. Prozesse an sich haben hier wenig Eigenwert, alles läuft entweder auf ein Ziel zu oder bleibt wertlos. Die unfassbar aufwendige Entstehungsgeschichte von Massive Attack's „Mezzanine“ belegt dies: Unzählige Stunden Material aus Jam-Sessions wurden schlicht verworfen, weil sie nicht ins Konzept passten. Anschließend schrieb man in einem ebenso aufreibenden Prozess komplett neue Songs, die wieder in unzähligen Produktionsrunden verfeinert und transformiert wurden. Wären auch diese Sessions fruchtlos geblieben, hätte es keinen Zwischenstand und keine Rohversionen gegeben – sondern schlicht gar nichts.
Umstrittene Polarität
In den vergangenen Jahren wird die Polarität zwischen extremer Produktivität einerseits und einem vor sich hin tröpfelnden Output andererseits heißer diskutiert denn je. Was daran liegt, dass diese Aspekte nicht mehr nur den kreativen Bereich betreffen, sondern zudem eine Frage der optimalen Geschäftsstrategie geworden sind. Der Songwriter Matt Farley kann ein Lied davon singen. Oder genauer gesagt 14,000 Lieder. Denn so viele hat Farley inzwischen geschrieben und auf sämtliche Online-Dienste zum Streamen und Herunterladen verteilt. In der Summe ergibt sich daraus ein durchaus passables Einkommen. Auch im Hip-Hop scheint sich die Doktrin des „mehr ist mehr“ durchzusetzen. Kein Wunder somit, dass sich hier mit Produzenten und Rappern wie Gucci Mane, Lil B und Future einige der veröffentlichungswütigsten Künstler unserer Zeit finden. Bei Gucci Mane mag man das nach einer abgesessenen Gefängnisstrafe noch als Nachholbedarf verstehen. Bei Lil B hingegen nahm die Produktivität zeitweise nahezu manische Dimensionen an. Zwischen 2010 und -13 nahm der ausgeflippte Rapper 22 Alben auf, teilweise mit Spiellängen, welche weit über die Speicherkapazität der CD hinaus gehen. Auch Future durchlief eine ähnlich exzessive Phase, als seine beiden Debüt-Alben sich wie bei einem Staffellauf an der Spitze der US-Charts abwechselten – ein Unikum.
Interessanterweise ist diese Produktivitätssteigerung zumindest teilweise auf innovative neue Formate zurückzuführen. So hat sich neben dem regulären Album noch das Mixtape (eine kostenlos angebotene Veröffentlichung, bei der lockerer mit Copyright und Sampling umgegangen werden kann) sowie die Playlist (die stilistisch offener und freier, oftmals auch länger ist) durchgesetzt. Diese neuen Formate tragen nicht den Nimbus der Perfektion mit sich, der vielen Alben anhaftet, und haben sich größtenteils von dem physischen Tonträger losgesagt. Wo genau die Linien zwischen diesen Formaten laufen, bleibt unklar. Bestes Beispiel: Drake, bei dem das epische Album „Scorpion“ kaum noch von einer Playlist wie „More Life“ oder einem Mixtape wie „If You're Reading This It's Too Late“ zu unterscheiden ist. Komplett anhören kann sich so viel Material so oder so kaum noch jemand, aber in gewisser Weise ist das auch der Punkt bei der Sache. Gucci Mane genießt allein aufgrund der Tatsache, dass er fast monatlich ein neues Album anbietet, eine gewisse Notorität – und die bestimmt seinen Marktwert. Die Produktivität von Drake wiederum führt dazu, dass man nahezu immer einem seiner Tracks ausgesetzt wird, egal ob man Radio hört, eine App öffnet oder sich in Spotify einloggt. Passenderweise platzierten sich alle 25 Tracks von „Scorpio“ gleichzeitig (!) in den amerikanischen Single-Charts.
Am Tropf der Dürre
Doch auch aus einer Strategie der „Dürre“ lässt sich Kapital schlagen. Fans eines Acts wie Jay Electronica hängen wie Krankenhauspatienten an einem Tropf, der nur in unendlich langen Zeitabständen wieder mit frischen Inhalten gefüllt wird. So gilt Jay als ein Riesenversprechen, obwohl er in fast einem Jahrzehnt gerade einmal drei Songs herausgebracht hat (die Compilation „What the F**K is a“ scheint eher eine Sammlung roher Demos zu sein). Die Wirkung ist das genaue Gegenteil der Flut: Es entwickelt sich ein ungemein vertrautes Gefühl mit dem wenigen Material, das einem zur Verfügung steht. Der Stress, der Release-Wut produktiver Künstler hinterher hecheln zu müssen, entfällt. 16 Jahre lagen zwischen dem zweiten und dritten Leftfield Album - eine kleine Ewigkeit, in der man sich immer wieder in „Leftism“ und „Rhythm and Stealth“ hineinhören, feine Details entdecken und auch die hervorragenden Remixe wertschätzen konnte. Mir schien schon immer, dass es nicht Drake's Material-Flut ist, welche die Musik zu einem Soundtrack zum eigenen Leben macht, sondern vielmehr die bewusste Zurückhaltung, dank der Alben zu Freunden und Wegbegleitern werden.
Letzten Endes ist alles natürlich auch eine Frage des Gemüts. Exzessive Produktivität ist üblicherweise das Resultat extremer Situationen. Das war unter anderem auch bei Brian Caroll so, der innerhalb kurzer Zeit Vater und Mutter verlor und dem eine schwere Herzerkrankung diagnostiziert wurde. Nach einer Phase tiefer Trauer überwunden war, ging es auch mit den Album-Veröffentlichungen zurück: 2017 waren es nur noch 30 Stück.