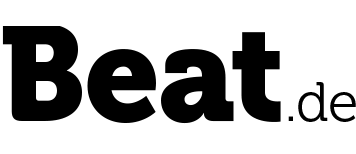Viele Künstler bestehen inzwischen auf dem Recht, über die Veröffentlichung eines Interviews das letzte Wort zu behalten. Die zunehmend harte Mentalität ist als Gegenreaktion gegen unseriöse Redakteure entstanden, doch das Pendel ist aus dem Gleichgewicht geraten – riskiert der Musikjournalismus, zum Betrug am Leser zu werden?
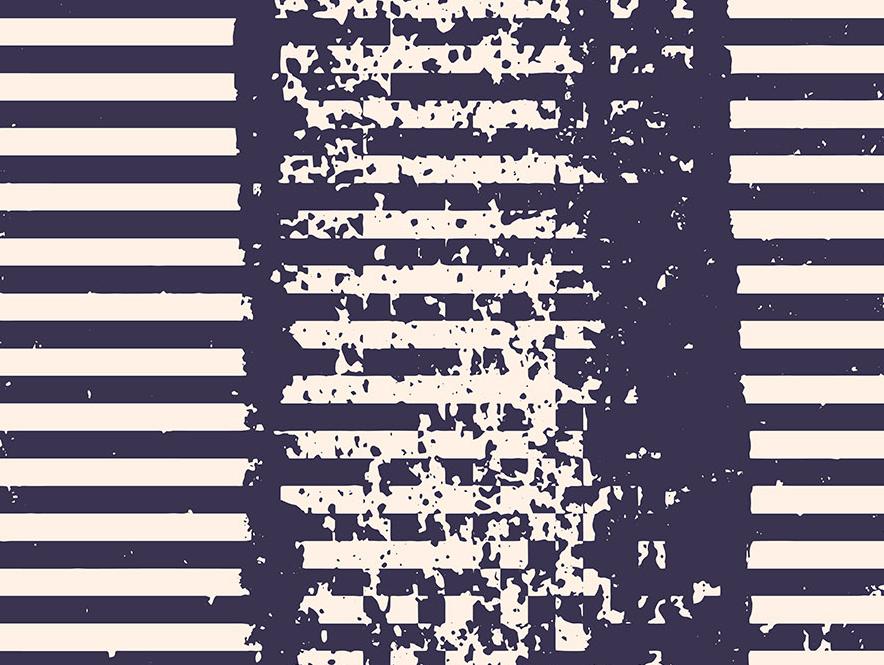
Als Journalist wünscht man sich Gesprächspartnerinnen wie Lira Bajramaj. So ist die Fußball-Nationalspielerin dafür bekannt, dass sie nicht um den heißen Brei herum redet, klare Worte findet und nicht zu viel über die Auswirkungen ihrer Aussagen reflektiert. Bajramaj, um im passenden Jargon zu bleiben, schießt aus der Hüfte. Als sportbegeisterter Leser bekommt man von diesem frischen Wind jedoch eher selten etwas mit. Zwar durfte sich die taz zunächst über schöne Zitate freuen, als Bajramaj im Interview dem im WM-Finale 2006 wegen einer Tätlichkeit gegen Marco Materazzi des Rasens verwiesenen Zinedine Zidane einen Ratschlag auf den Weg mitgab: „Wenn man schon Rot kriegt, dann würde ich ihm auch gleich richtig die Nase brechen.“ Unter anderem diese Textstelle wollte Bajramaj's Management anschließend aber nicht mehr stehen lassen und strich sie aus der zur Autorisierung vorgelegten Fassung. Die taz berief sich auf den auf Tonband festgehaltenen Wortlaut und druckte neben der geschönten Version auch die besagten „Kracher“ mit ab. Die Aktion stellt in der deutschen Medienbranche eher die Ausnahme dar. Was wir in Zeitungen, Zeitschriften, Blogs und Online-Magazinen über Sportler und Kultur-Schaffende aus allen Bereichen lesen, ist üblicherweise zurechtgestutzt, geschönt und sterilisiert. So gilt für das Interview als Format, wie die ehemalige taz-Chefredakteurin Bascha Mika es einmal radikal auf den Punkt gebracht hat: „Es suggeriert Authentizität, dabei geht es um Betrug. Betrug am Anspruch einer freien Presse, Betrug am journalistischen Selbstverständnis, Betrug am Leser.“ Die Kritik aber geht weiter über das Interview hinaus – und könnte leicht auf den Musikjournalimus als Ganzes angewandt werden.
Angestoßen wurde die Debatte in der Politik, als der Hamburger Bürgermeister und SPD-Politiker Olaf Scholz 2003 ein Interview gab, welches er anschließend drastisch verändern lassen wollte. Üblicherweise landen solche unerträglich langweiligen Texte entweder etwas versteckt weiter hinten im Heft oder in der Tonne. In diesem Fall aber fanden sie ihren Weg in die gedruckte Ausgabe, in der die zahlreichen Stellen, welche Scholz so nicht mehr gelten lassen wollte, für den Leser ersichtlich mit dem Schwarzstift weggestrichen worden waren. Seitdem dringen in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Beispiele für die Redaktions-Wut prominenter Befragter ins mediale Rampenlicht. Bekannt geworden sind dabei vor allem Oli Kahns nahezu komplett ausgeschwärztes Gespräch für die Zeit, Helge Schneiders Weigerung, gerade die spannendsten Stellen einer tiefen Konversation für den Playboy freizugeben oder Julian Assanges Auskunftsfreudigkeit in 50 extrem persönlichen Interview-Stunden mit Andrew O'Hagan, die ihm dann aber plötzlich allesamt „zu persönlich“ erschienen. Wenn die Thematik in den letzten Jahren ein wenig unter den Tisch gefallen zu sein scheint, dann deswegen, weil viele Prominente inzwischen von PR-Beratern dermaßen auf Professionalität gedrillt werden, dass sie vor laufendem Mikro ohnehin nur noch belanglose Worthülsen zu Protokoll geben und sich die Medienwirksamkeit einer „Enthüllungs-Veröffentlichung“ im Stile der taz und Zeit inzwischen doch ein wenig überholt hat. Hinter den Kulissen aber finden die Auseinandersetzungen weiter statt – und werden teilweise mit sogar noch härteren Bandagen ausgetragen.
Es fliegen die Fetzen
Dabei gibt es in Deutschland trotz der international gesehen verhältnismäßig restriktiven Autorisierungspraxis keinen Paragrafen, der es Journalisten explizit zur Pflicht macht, einen Interview-Text offiziell absegnen zu lassen – anders als beispielsweise in Polen, wo sich ein eben solches Regelwerk als Relikt aus der kommunistischen Diktatur bis heute gehalten hat. Auch gehen die Ursprünge des Brauchs nicht auf Stars und Sternchen zurück, sondern vielmehr auf die journalistische Zunft selbst. Als der Spiegel in den 1950ern sein Tiefengespräch einführte, in dem nicht mehr Höflichkeiten ausgetauscht wurden, sondern die Fetzen flogen, diente die Autorisierung dazu, Politiker davon zu überzeugen, an einem derart intensiven Gespräch überhaupt teilzunehmen. Der Rest der Branche schaute sich die Praxis ab und sie ist bis heute Usus geblieben, allen gelegentlichen Unkenrufen zum Trotz. Dafür gibt es auch gute Gründe. Denn in seiner positiven Form dient die Autorisierung der Herstellung der Waffengleichheit zwischen Interviewer und Befragtem. Einerseits erhält der Journalist die Möglichkeit, das Gespräch zugunsten der Leser und des Künstlers redaktionell zu bearbeiten – wer einmal ein unredigiertes Interviewmanuskript gelesen hat, weiß um den Wert dieser Arbeit, die weit über das Herausschneiden von Füllwörtern und Wiederholungen hinausgeht. Andersherum erhält der Befragte die Chance, diese neue Version auf Unstimmigkeiten hin zu überprüfen. Dabei können auch offensichtliche Missverständnisse ausgemerzt werden. In einem Beispiel aus eigener Erfahrung gaben mein Bruder und ich vor Kurzem ein Interview zum Thema „Streaming“. Nach dem sehr interessanten Gespräch erhielten wir die redigierte Fassung vorgelegt, die sich gut las, aber an einer entscheidenden Stelle das genaue Gegenteil einer Aussage enthielt. Solche Fehler auszuräumen, sollte allen Beteiligten ein Anliegen sein.
Sobald es um die „großen Namen“ geht, haben sich beide Seiten aber leider inzwischen derart auf die Negativbeispiele eingeschossen, dass von einem konstruktiven Dialog keine Rede mehr sein kann. Viele Jahrzehnte lang lag die Hebelwirkung dabei zunächst einmal bei den Medienvertretern. Vor allem in den 1960ern-80ern, als Verlagshäuser ihre größte Expansion erlebten, scherten sich viele um eine Autorisierung wenig bis nichts und feierten gerade mit Skandalen kommerzielle Triumphe. So behauptete Albert Goldman in seiner Elvis-Biografie, der King sei schwul und untalentiert gewesen, in seinem Lennon-Buch, der ehemalige Beatle habe eine Affaire mit dem Band-Manager Brian Epstein geführt und sei möglicherweise von Yoko Ono umgebracht worden. Kitty Kelley folgte mit einer Biografie Frank Sinatras, die den Mann mit der goldenen Stimme als einen alkoholsüchtigen Gewalttäter mit Verbindungen zur Mafia porträtierte. Die Nicht-Autorisierung trug bei diesen Titeln sogar noch zu ihrer Aura bei, ließ sie als Offenbarungen bewusst vertuschter Geheimnisse erscheinen. Doch hat sich das Blatt längst gedreht. Zwar haben Journalisten rein rechtlich nahezu immer die Möglichkeit, auch ein nicht freigegebenes Interview dennoch abzudrucken – nämlich, indem es im exakten Wortlaut oder als Fließtext mit entsprechenden Zitaten erscheint. Doch gewähren viele Prominente inzwischen gar keine Audienz mehr, ohne dass ihr Gegenüber einen ganzen Katalog an Restriktionen unterschreibt. Dazu gehört üblicherweise das Recht, eine nicht freigegebene Version schlicht zu verbieten, über die Auswahl von Fotos und Zitaten entscheiden zu dürfen sowie, wie beispielsweise bei Till Schweiger, eine Klausel, die es der Presse darüber hinaus untersagt, ein solches Interview überhaupt in irgendeiner Form zu erwähnen. Entweder es erscheint zu den Konditionen des Künstlers, oder es hat, in einer Wendung, die ein wenig an George Orwells „1984“ erinnert, gar nicht stattgefunden. Hinzu kommt noch, dass der Gesetzgeber indirekt die Position der Prominenten stärkt, indem er ihnen Urheberrechte an dem fertigen Interview sowie Persönlichkeitsrechte einräumt, welche ein gewisses Maß an Kontrolle darüber zulassen, was in der Öffentlichkeit verbreitet werden darf und was nicht. Diese Rechte nutzte beispielsweise Herbert Grönemeyer in seiner Unterlassungsklage gegen die erste Auflage von Ulrich Hoffmanns unautorisierter Grönemeyer-Biografie, in der Hoffmann mangels der Unterstützung des Musikers großzügig aus früheren Gesprächen zitiert hatte.
Falsche Filter
Diese Rechte haben freilich nicht nur ihren Platz, sondern sind sogar extrem wichtig in einer Medienlandschaft, in der die Fehlerhäufigkeit aufgrund des schwindelerregenden Umsatz-Tempos und der gezielten Streuung von Falschmeldungen zugenommen hat. Gerade, weil die Auswirkungen solcher Fehler verheerend sein können (Stichwort: Shitstorm) und weil sich zu viele Publikationen im Zweifelsfall für Quote und Besucherzahlen und gegen den Schutz der solchermaßen Bloßgestellten entscheiden, muss der Schutz des Einzelnen gewahrt bleiben. Problematisch aber wird die Angelegenheit, wenn sie sich in das genaue Gegenteil verkehrt und Künstler zu den Filtern der Berichterstattung werden und selbst ihre eigene Geschichte schreiben. Auch ich musste dies erfahren, als mich ein Label bat, für einen in Ambient-Kreisen recht bekannten Musiker Liner Notes für eine anstehende Wiederveröffentlichung zu verfassen. In einem kurzen historischen Absatz zitierte ich dabei ehemalige Kollegen von ihm mit augenscheinlich recht unspektakulären Aussagen. Dies wurde von dem Künstler mit harten Worten abgelehnt, da diese Aussagen seine eigene Bedeutung herunter spielten. Ein Korrekturvorschlag wurde mit der Drohung abgelehnt, er werde keine Version des Textes freigeben, solange die strittigen Passagen in irgendeiner Form darin enthalten seien. Um eine Lösung des Konflikts kamen wir herum, weil die Veröffentlichung letztendlich nicht stattfand, aber angesichts solcher drakonischen Situationen kann es kaum verwundern, dass die Berichterstattung über Musik zunehmend schulterklopfend und beweihräuchernd wirkt. Von der Forderung des legendären Journalisten Chuck Klosterman, es müsse zwischen Interviewer und Musiker ein „gewisses Spannungsverhältnis“ bestehen, ist leidlich wenig übrig geblieben. „Zu der Zeit, als ich für das Feuilleton von Zeitungen arbeitete, gab es eine einfache Regel“, so Klostermann. „Wenn du die Band mochtest, mit der ein Interview geplant war, warst du raus aus der Geschichte.“
Dabei könnte die Diskussion weitaus produktiver gelöst werden. Zurecht hat der Autor Peter Köpf darauf hingewiesen, dass Grönemeyer, statt die Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte untersagen und sich nachträglich darüber beschweren zu wollen, doch einfach an ihr hätte mitwirken können. Auch stummes Beobachten kann ein probates Mittel sein. So geschehen bei Paul Brannigans Biografie des Nirvana-Drummers und Foo-Fighter-Kopfes Dave Grohl. Grohl wollte an der Entstehung des Buches aus verschiedenen Gründen zwar nicht beteiligt sein, ließ Brannigan aber einfach machen und las das Ergebnis dem Verlautbaren nach, gar nicht erst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und steht sinnbildlich für eine Situation, in der Autor und Subjekt in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen bleiben.
Das vielleicht beste Beispiel eines solchen Projekts ist Julian Cope's berühmter „Krautrocksampler“, den der Musiker 1988 im Rausch herunter schrieb und zu einem Zeitpunkt, als keiner die darin behandelte Musik ernst nahm. Alle in dem Buch genannten Bands sind sich einig, dass die Recherche einiges zu wünschen übrig ließ. Was man jedoch spürt, ist die bedingungslose Liebe und Leidenschaft zum Sujet sowie der dringende, heißblütige Wunsch, diese mit anderen zu teilen. Cope hat das kleine Büchlein nie korrigiert, es aber auch nie neu veröffentlicht um von dem sich darum rankenden Kult zu profitieren. So bleibt es ein inspirierender kurzer Augenblick, ungeschönt und mit all seinen Fehlern – ganz so, wie ein gutes Gespräch eben auch.
Dieser Artikel ist in unserer Heft-Ausgabe 138 erschienen.