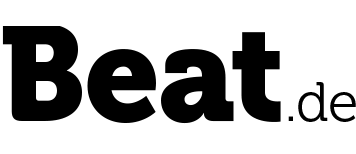Wer die eigene Musik für wertlos hält, ist nicht allein. Sogar einige der größten Künstler werden von Zweifeln heimgesucht. Bestätigung von Freunden, Familie und Fans hilft oft nur wenig. Nachgedacht haben über das Phänomen unzählige Musiker, Philosophen und Psychologen – haben sie eine Lösung parat?
Manchmal braucht es nicht viel um einen Sturm auszulösen. „Ich interessiere mich für nichts anderes als Musik – und meine Musik ist Müll. Was fange ich nur mit meinem Leben an?“ schrieb ein Reddit-Forumsmitglied knapp und schlicht. Hilferufe wie dieser verschwinden üblicherweise recht rasch in der Versenkung. Dieser aber nicht. Schon bald häuften sich die Antworten, Mitleidsbekundungen und Ratschläge, bis schließlich hunderte Kommentare zusammengekommen waren. Die spontanen und mitfühlenden Reaktionen bezeugen, dass der Poster offensichtlich einen Nerv getroffen hatte. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Denn obwohl die Zahl der Heimmusiker weiter steil zunimmt, haben auch günstige Software- und Hardwarelösungen die Kluft zwischen ihrer Musik und professionellen Produktionen nicht schließen können. So nimmt der Frust eher zu, denn ab: Das Ziel, auf Weltklasseniveau mitmischen zu können, rückt in immer weitere Ferne, die eigene Musik erscheint bestenfalls als ein Inbegriff des Mittelmaßes.

Nun gehören von Minderwertigkeitsgefühlen geprägte Phasen dazu, wenn man sich kreativ betätigen möchte. Alle Künstler haben sie – von aufstrebenden Talenten bis hin zu gefestigten, etablierten Superstars. Der Psychologe Rod Judkins erinnert sich daran zurück, wie David Bowie eine seiner Vorlesungen besuchte, wie extrem unsicher er wirkte und seine eigene Bedeutung als Pop-Musiker gegenüber der eines Psychologen zurückstellte. Ähnliches, so Judkins, habe er auch bei Ridley Scott und Dennis Hopper beobachtet, während ihm Kate Winslett ihr Leid klagte, jeden Morgen mit dem Gefühl aufzuwachen, heute sei der Tag gekommen, an dem die Welt endgültig feststelle, dass sie als Schauspielerin nichts tauge. Nur eine einzige kritische Stimme kann das sorgfältig aufgebaute Selbstbild zerstören. Es mag tröstlich sein, dass andere sich mit denselben Problem herumschlagen – helfen aber tut es nur bedingt.
Harte Tatsachen
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie man scheitern kann: Entweder in Bezug auf öffentliche Anerkennung oder die hohen Ansprüche an das eigene Werk. Wenn mangelnder Erfolg der Auslöser für die Depressionen ist, sollte man eines verstehen: Jeder scheinbar plötzliche Sprung an die Spitze ist in Wahrheit lang und sorgfältig orchestriert. Auch, wenn Whitney Houston erst 22 war, als ihr Debütalbum alle Rekorde brach, hatte sich der Erfolg alles andere als über Nacht eingestellt. Bereits mit 11 Jahren war sie als Sängerin so gereift, dass sie Solistin in ihrem Gospelchor wurde, mit 15 sang sie auf einer Chaka-Khan-Platte, später sogar auf dem Kultklassiker „One Down“ der Experimentalband Material. Nebenbei erweiterte sie das eigene Profil durch hoch angesehene Model-Jobs. Als „Whitney Houston“ erschien, war die Debütantin bereits in gewisser Weise eine erfahrene Musikerin.
Was hinzu kommt: Houston's märchenhafter Aufstieg war eingebettet in ein Umfeld aus Kräften und Beziehungen, die sie ganz natürlich nach oben treiben ließen. Dionne Warwick war ihre Cousine, Aretha Franklin eine Ehren-Tante, ihre Mutter Cissy eine Sängerin. Gemeinsam tourten Mutter und Tochter bereits lange bevor von einem Plattenvertrag die Rede war. Erfolg ohne jegliche Beziehungen und harte, langjährige Arbeit existiert somit nicht. Das jedoch bedeutet nicht automatisch, dass man den Traum einer Künstlerexistenz begraben muss. Gerade im Mittelfeld tummeln sich die wirklich interessanten Musiker, die unbehelligt vom Dauerbombardement der Medien ihre kreative Vision ausleben können. Erfolg bedeutet hier: Eine tiefe Dankbarkeit dafür, mit einem so sehr von Geschmack, Zeitgeist und flüchtigen Emotionen abhängigen Produkt wie Musik die Existenz bestreiten zu können. Der Photograph Frank Rodick beschreibt diese Dankbarkeit recht treffend als ein Gefühl völliger Losgelöstheit: „Die Welt ist mir nichts schuldig. Keine Zuneigung, keinen Respekt, nicht einmal Anstand. Und sie schuldet mir ganz bestimmt kein Geld oder finanzielle Absicherung.“ In gewisser Weise gehöre die ständige Unsicherheit sogar zur Existenz als Künstler dazu.
Ungehört und ungeliebt
Nun sind sich die meisten Musiker dieser Tatsachen zweifelsfrei bewusst. Und nur wenige wollen wirklich bis ganz nach oben - nach dem tragischen Selbstmord von Tim Bergling liegt die dunkle Seite des Ruhmes so offen da wie nie zuvor. Vielmehr treibt viele Kreative einfach nur die Sorge um, die eigenen Tracks könnten ungehört und ungeliebt in der Versenkung verschwinden. Bis in die 90er hinein bestand das Haupthindernis darin, einen guten Sound zustande zu bekommen. Wer sich Demos aus den 80ern anhört, versteht sofort, warum Aufnahmestudios seinerzeit als Drehtür zum Ruhm betrachtet und Produzenten als Gurus gepriesen wurden. Heute bekommen oftmals sogar blutige Anfänger mit nur wenigen Monaten Erfahrungen einen „amtlichen“ Sound hin – die logische Konsequenz von Youtube-Tutorials und Kursen an Online-Akademien. Abmischen und Mastern ist letzten Endes ein Handwerk und wer sich mit genug Leidenschaft darin versenkt, wird sehr rasch beachtliche Fortschritte verbuchen können.
Gleiches gilt im Grunde genommen genauso für Songwriting und Arrangieren. Ein Quäntchen Magie wird immer bleiben, vieles aber lässt sich erlernen. Wer die eigene Musik als unzureichend empfindet, braucht nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sollte vielmehr die eigentliche Quelle der Unzufriedenheit isolieren: Sind es die Beats, die nicht grooven wollen? Die Sounds, die dünn und uninspiriert klingen? Die Songideen, die nicht zünden? All das lässt sich durch intensives Studium, Recherche und unermüdliches Feilen verbessern. Das eigentliche Ziel darf dabei nur niemals sein, so schnell wie möglich den Durchbruch zu schaffen. Eine strenge Qualitätskontrolle und viel Geduld können gelegentlich eine weitaus bessere Strategie sein, als den Markt mit Musik zu überfluten. Bestes Beispiel: Das italienische Duo Mind Against. Die beiden Brüder Alessandro und Federico Fognini gelten bereits seit Jahren als eines der spannendsten Produzentengespanne der Szene. Als ich sie in ihrem Studio besuchte, zeigten sie mir Festplatten voller Musik, unendliche Listen voller Songs, die alle hervorragend klangen, aber ihrer Meinung nach gerade nicht gut genug waren. Bis heute haben Mind Against kein einziges Album und lediglich neun EPs veröffentlicht. Doch jede davon gilt als ein kleines Meisterwerk.
Einer der vielleicht wichtigsten und oftmals unterschätzten Möglichkeiten, als Künstler zu reifen, besteht in dem ständigen persönlichen Austausch mit anderen Musikern. DJ und Produzentin Anii erzählte im Beat-Interview letzten Monat, dass ihre Zeit an der Point Blank ihr viel gebracht habe, betonte aber: „Noch wichtiger als die Wissensvermittlung war, dass du die ganze Zeit mit Anderen an konkreten Projekten gearbeitet hast.“ Diese Art von Wachstum durch Austausch und Teamarbeit fehlt vielen Musikern und man sollte alles daran setzen, das zu ändern. Denn: Die Vorstellung des genialen Einzelkünstlers ist eine der vielen sorgfältig gepflegten Mären der Musikindustrie. Jemand wie David Bowie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sich Kunst nur in einem Umfeld inspirierender Kollegen voll entfalten kann. Den Sprung, den so manche von Heimproduktionen zur ersten Profi-Produktion vollzieht, ist oftmals auf die Beiträge anderer Musiker zurückzuführen, die sich mit ihrem Talent in den Dienst des Projekts stellen.
Die Zweifel bleiben
Die beständige Optimierung der eigenen Fähigkeiten ist eine sichere Methode, als Künstler besser zu werden. Niemals aber wird sie nagende Selbstzweifel vollkommen ausräumen können. Psychologen bezeichnen das als „Betrüger-Syndrom“. Die weltweit führende Expertin zu diesem Thema, Dr. Valerie Young, identifiziert fünf Grundtypen:
• Die Perfektionistin, die die eigenen Ideal nie ganz umsetzen kann.
• Die Superfrau, die meint, durch absurd hohe Arbeitsmengen die eigenen Unzulänglichkeiten ausgleichen zu können.
• Diejenigen, die meinen, dass harte Arbeit ein Beleg dafür ist, dass sie kein Genie sind.
• Die Solistin, der nur zufrieden ist, wenn sie alles alleine schafft.
• Und schließlich die Expertin, die meint, dass einen nur ein allumfassendes Wissen kompetent mache.
Youngs Kategorisierungen mögen ein wenig vereinfachend und banal daherkommen. Doch werden sich die meisten in einer dieser Kategorien wiederfinden. Das wiederum zeigt auf, wo Veränderungen notwendig sind.
Stärken als Schwächen
Vielleicht hilft es auch zu verstehen, dass jeder, der die eigene Musik ernst nimmt, gerade oftmals an persönlichen Stärken, nicht Schwächen verzweifelt. Der Autor Jeff Goins beschreibt das folgendermaßen: „Das, was uns Kreative antreibt, ist unser guter Geschmack. Aber die Sachen, die du in den ersten Jahren machst, sind einfach nicht besonders gut. Dein Geschmack ist hingegen bereits herausragend. Und genau deswegen enttäuscht dich dein eigenes Werk.“ Man könne und müsse dieser Diskrepanz ehrlich in die Augen sehen, so Goins, weil sie sich letztendlich gar nicht ausräumen lasse. Als Künstler sehe man immer das perfekte, ideale Werk vor sich, das aber in der Realität nicht zu erreichen sei. Stattdessen müsse man sich damit zufriedengeben, dass Musik niemals komplett fertig ist und nur so gut, wie es eben in diesem Augenblick gehe. Die Kunstkuratorin Michelle Gaugy beschreibt das so: „Fang einfach an. Tue, was du tust und erreiche, was du an diesem Tag erreichen kannst. Vielleicht arbeitest du nur an einem einzigen Bild, vielleicht an mehreren gleichzeitig. Das ist egal. Wenn du müde bist oder das Interesse verlierst, hörst du auf. Dann hast du genug geschafft.“
Wie schon die Weisesten wussten, sollte man sich und die eigene Musik auch nicht zu ernst nehmen. Der norwegische Autor Karl Ove Knausgaard hat in dieser Hinsicht eine interessante Gegenperspektive anzubieten: „Glaube ja nicht, dass du irgendwer bist. Das bist du nämlich nicht. Du bist nur ein selbstgefälliges kleines Stückchen Scheiße. Also halte deinen Kopf nach unten und arbeite, du kleines Stück Scheiße. Dann wird vielleicht noch was draus.“ (Karl Ove Knausgård: Lieben. Luchterhand, München 2012). Knausgaard glaubt nach eigenem Bekunden bis heute, dass er nichts wert sei. Geworden ist aus ihm freilich eine ganze Menge.