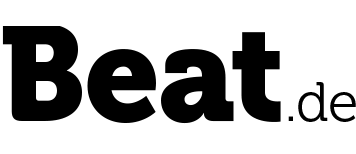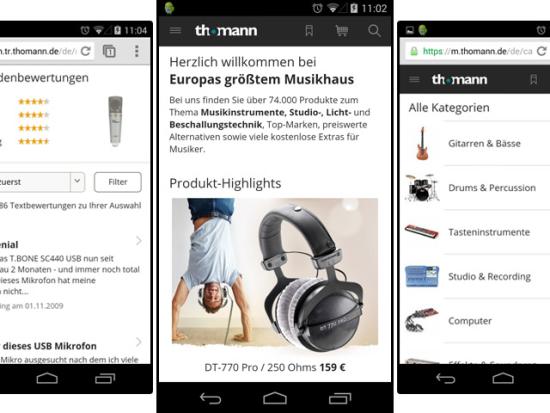In ihrem Eifer, der Online-Piraterie den Kampf anzusagen, hat es die Musikindustrie versäumt, eine bedeutend wichtigere Frage zu beantworten: Warum kaufen Leute überhaupt Musik? Die Antworten auf diese Frage sind teilweise überraschend – wer sie für sich zu nutzen weiß, könnte die Krise zu seinen Gunsten wenden.von Tobias Fischer

Ein später Samstag Nachmittag in Berlin-Neukölln. Draußen ist es kalt, dunkel und nass, doch in dem kleinen Plattenladen „Rumpsti Pumsti“ ist die Stimmung bestens. In der angeschlossenen Galerie steigt die Eröffnungs-Vernissage zu einer neuen Ausstellung und statt verkopfter Avantgarde-Kunst gibt es großartige Unterhaltung. Schon beim Betreten wird man von freundlichen Gesichtern und Lachen begrüßt, weiter hinten dann wuseln die Besucher wie eine Gruppe Kindergartenkinder mit weit aufgesperrten Augen durch den vielleicht zehn Quadratmeter großen Ausstellungsraum. An den Wänden hängen die Plattencover sämtlicher Hits, welche in den deutschen Charts zwischen 1953 und 1993 die Nummer-eins-Position erreicht haben. Den Anfang macht das unmöglich betitelte „Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand“ von den Kilima Hawaiians, den Abschluss bildet Haddaways „What is Love“ und dazwischen liegen 428 weitere Singles, die vom unsterblichen Klassiker bis zur unfassbaren Geschmacksverirrung reichen. Kennen tut man die meisten dieser Gassenhauer, mitgegrölt hat man so manchen davon, doch wie viele mag man davon im Regal stehen haben?
Mario Passarotto hat sie alle. Dass er sie nun mit der Welt teilt, scheint weniger auf konzeptionelle Gründe als vielmehr ein ein soziales Bedürfnis zurückzuführen und man sieht ihn mit einem breiten Grinsen mit vielen der Gäste diskutieren. Und dennoch bleibt so manches ungeklärt: Was bewegt jemanden, eine derart riesige Sammlung anzulegen? Und: Was bewegt jemanden überhaupt noch dazu, Musik zu kaufen, wo sie doch spätestens seit der Erfindung des Radios praktisch überall, ununterbrochen und frei zur Verfügung steht? Die Thematik ist durchaus nicht so trivial wie sie scheinen mag – und die daraus gewonnen Erkenntnisse könnten der Kreativindustrie neue Hoffnung spenden.
Interessanterweise haben sich die Major-Labels in den vergangenen fünfzig Jahren aber vor allem mit einem anderen, aber artverwandten Rätsel auseinandergesetzt – der Frage nämlich, warum ungefähr fünfzig Prozent der Bevölkerung überhaupt keine Musik kauft, obwohl sie ihnen laut Umfragen wichtig bis sehr wichtig ist. Diese Tendenz ist eher noch gestiegen und das, obwohl es laut dem Wired-Autoren Paul Boutin eigentlich gerade anders herum sein müsste: „Freunde, ein Song kostet gerade mal einen Dollar und Walmart hat manche seiner MP3s auf 64 Cents herunter gesetzt. Bei Grooveshark kann man praktisch jeden Song antesten, bevor man ihn kauft. Und Rdio verlangt nur $5 im Monat für uneingeschränkten Musikgenuss in der Cloud. Es gibt also wirklich keinen Grund, keine Musik zu kaufen.“ [1] Und dennoch bereitet der bemerkenswert kleine Anteil der sogenannten Intensivkäufer, unter die alle fallen, die im Jahr mehr als neun Alben kaufen, der Branche den Löwenanteil ihrer Umsätze. Die höchsten Durchschnittsausgaben haben dabei, wie eine Insider-Publikation weiß, „nach wie vor die 40- bis 49-Jährigen, die zwar nur 19 Prozent der Bevölkerung ausmachen, dabei aber für ein Viertel der Umsätze am Musikmarkt sorgen.“ [2] In diesem Segment zählen genau die Werte, welche der neuen Generation von Konsumenten verloren gegangen zu sein scheinen: eine Liebe für ansprechende physische Verpackungen, ästhetisch aufbereitetes Infomaterial und aufwendig produzierte Editionen. Verfügbar aber ist ein Großteil auch dieses Materials schon längst bei Spotify und Co. Was also bewegt so manchen, sechzig Euro für die 40th Anniversary Edition von Miles Davis’ Jazzrockklassiker „Bitches Brew“ auszugeben?
Politische Motivationen
Die wohl ersten großen Untersuchungen zum Thema fanden in den USA in den Siebzigern statt und waren hauptsächlich politisch motiviert. Man war daran interessiert, in wiefern sich Klassenunterschiede auf das kulturelle Konsumverhalten auswirkten, und führte dazu großangelegte Studien durch, die – nicht überraschend – Bildung und Einkommen als Haupteinflussfaktoren isolierten sowie eine Präferenz der höheren Schichten für Klassik und andere angeblich anspruchsvolle Genres. [3] Dabei hatte der Kanadier Glenn Gould bereits lange davor einige der wahrhaft wichtigen Gründe für den Erfolg von Schallplatten auf den Punkt gebracht. Gould, den viele für den größten Pianisten aller Zeiten halten, verließ 1964 die Konzertbühne und konzentrierte sich vollkommen auf seine Karriere als „Recording Artist“. Er tat dies aus der Überzeugung heraus, dass eine LP dem Hörer bedeutend mehr Freiheit einräume, die Musik zu seinen eigenen Bedingungen zu genießen. Even Eisenberg hat diese Haltung in seinem Buch „The Recording Angel“, einer Art philosophischer Leitfaden für Musik im Zeitalter ihrer mechanischen Reproduktion, charmant karikiert anhand seines Freundes Tomas, der sich zum Klang von Wagner gerne in seinem eigenen Zimmer auf die Knie schmiss oder, überwältigt von den Emotionen, auf dem Boden herumrollte. Das, was Tonträger einem Käufer bieten, sei vor allem eine zeitliche Loslösung des Hörvorgangs von dem Prozess der Musikaufführung: „Jetzt konnte man [Gustav Mahlers] „Symphonie der Tausend“ ganz alleine hören. Man konnte Nocturnes zum Frühstück hören, Vespern am Mittag und das Osteroratorium zum [jüdischen] Hanukkah-Fest. […] Man konnte Sex haben zur Matthäus-Passion. Alles war möglich, nichts war mehr heilig; die Freiheit war (wenn man einmal von Beschwerden der Nachbarn und den gelegentlichen Restaurationsversuchen, wie beispielsweise dem Bann der orthodoxen Kirche auf Aufnahmen von Gebeten absieht) vollkommen.“ [4]
Auch wenn sich letztendlich eher wenige (so mag man wenigstens vermuten) dazu entschlossen, die Matthäus-Passion zur Untermalung ihres Geschlechtsverkehrs zu nutzen, so war doch das in dem krassen Beispiel enthaltene Versprechen tatsächlich der vielleicht grundlegendste Grund dafür, eine LP zu kaufen. Das kam für viele überraschend. Als Kathleen Lacher und Richard Mizerski in den Neunzigern ihr hedonisches Konsummodell vorstellten, bestand ihr Ansatz vor allem darin, Faktoren wie Klassenzugehörigkeit oder Bildung zugunsten von Wunschvorstellungen, Fantasien und Erwartungshaltungen des potenziellen Käufers bewusst auszublenden. Die Studien hingegen ergaben spektakulärerweise, dass die gerade bei Pop und Rock so oft ins Feld geführten Emotionen beim Erwerb von Tonträgern eine eher untergeordnete Rolle spielten. [5] Wichtiger sei vielmehr die von Eisenberg beschriebene zeitliche Kontrolle über das Material, die Möglichkeit, die Musik immer und immer wieder anhören zu können. Lachenberg und Mizerskis Entdeckung deckt sich mit einer aktuelleren Studie von Chasson Gracie und Ritika Sinha, welche die wohl bisher genauste Analyse der Musik-Konsumauslöser darstellt. [6] Wie die Autoren feststellten, sind es die kognitiven Hörer, also diejenigen, welche Musik auf eine sehr rationale und analytische Weise hören, welche den Musikkonsum ankurbeln – nicht die Gefühlsmenschen. Ein weiterer Aspekt sei darüber hinaus die Übereinstimmung des eigenen Geschmacks mit der von Mitgliedern des Freundeskreises. Genauer gesagt könne diese Übereinstimmung die Wahrscheinlichkeit, Musik zu kaufen, um bis zu 500 Prozent steigern. Dagegen kommt nicht einmal ein Platz in der Playlist von David Guetta oder ein Auftritt bei „Wetten dass …“ an und verdeutlicht, warum den Labels so viel an dem Thema Social Media gelegen ist. Denn um so größer der Freundeskreis, um so höher die Chance für Deckungsgleichheit – und folglich für den Tonträgerkauf.
Soziale Faktoren
Dass soziale Faktoren den Musikkonsum steuern können, führt direkt in das Herz der aktuellen Debatte hinein. Denn es mag augenscheinlich absurd erscheinen, dass sich immer noch Hunderttausende für den Kauf eines Albums entscheiden, wenn eben dieses bereits vor dem offiziellen Erscheinen auf CD kostenlos zum Streaming bereitsteht. Erklärbar werden solche Phänomene durch ein Menschenbild, wie es Gracie und Sinha trefflich formulieren, bei dem das Thema Fürsorge eine große Rolle spielt. Eine Künstlerin wie Lady Gaga hat diesen Gedanken geschickt zu ihren Gunsten ausgelegt. Einerseits kümmert sie sich scheinbar rührend um ihre kleinen „Monster“. Andererseits fordert sie von ihnen, sich andersherum auch um sie zu kümmern – beispielsweise durch den Erwerb der neuen Single, eines Ringtones oder einer Konzertkarte. Social Media rücken dabei den ehemals unerreichbaren Star in unmittelbare Nähe und vermitteln einem dabei das Gefühl, man unterstütze mit der finanziellen Transaktion unmittelbar dessen Wohl.
Dabei bedient diese augenscheinlich altruistische Aktion durchaus nicht nur uneigennützige Gefühle: „Mit dem Besitz eines Gutes beweist man eine gewisse Hingabe und Leidenschaft für einen Zweck“, so Richard Preedy [7], und North/Hargreaves kommen zu dem Schluss: „Weil es Zeit, Aufwand und Geld beinhaltet, ist das Kaufen von Platten vielleicht das ultimative Verhaltensmaß für musikalische Präferenz.“ [8] Die Zeit hat das einmal wie folgt formuliert: „Der echte Musikfan, der eingefleischte Intensivkäufer, der Tonträger-Junkie, der im Jahr mehr als zehn CDs kauft, will nicht mit der Nase auf den Eintagshit gestoßen werden, er will finden. Geheimnisvolle Musik will er finden, die sein CD-Regal von all den anderen unterscheidet, Musik, die ihn als „hip“ ausweist im Adelsstand der Kenner. Die Intensivkäufer – jeder Achte zählt zu dieser Gruppe – sorgen für fast die Hälfte des Umsatzes. Ihnen muss der Plattenladen den richtigen Rahmen bieten, Nischen der Intimität, wo sie, sich selbst und ihrer Neugierde überlassen, wühlen können zwischen den Covers, wo sie in Neuerscheinungen hineinhören und auch einmal an einer älteren Produktion hängenbleiben.“ [9] Wenn junge Hörer diese Mentalität für sich entdecken, könnte damit der Kauf und Besitz von Musik im Zeitalter ihrer vollkommenen Verfügbarkeit wieder zum ultimativen Differenzierungsmerkmal werden.
Letztendlich aber geht es so manchem Plattenkäufer nicht anders als dem schuhliebenden Vamp bei Zalando: Der Kauf selbst ist bereits die Belohnung. Wie es das Musikblog „A Cinema of Sunshine“ trefflich formuliert hat: „Vielleicht ist der Hauptgrund dafür, Musik zu kaufen, einfach, dass es sich gut anfühlt.“ [10]
[1] www.wired.com/magazine/2010/11/st_essay_nofreebird/
[2] www.musikindustrie.de/jahrbuch-musikkaeufer-2011/?no_cache=1&type=1
[3] http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/10045/Final%20Version%20Masterthesis%20Lennart%20Pieters%20CEandCE.pdf
[4] Evan Eisenberg: „The Recording Angel“.
[5] Herbert Jack Rotfeld: „Adventures in Misplaced Marketing“; S. 170
[6] www.graciemgt.com/wp-content/uploads/2012/09/Gracie-Management-Music-Consumption-Model%E2%84%A2-Report.pdf
[7] www.gfktechtalk.com/2011/03/29/consumers-are-moving-to-the-cloud%E2%80%A6so-why-are-people-still-buying-vinyl-records/
[8] A. C. North & D. J. Hargreaves (Hrsg): „Music and consumer behaviour. The social psychology of music“ S. 268-289
[9] www.zeit.de/1996/34/pop.txt.19960816.xml/seite-2
[10] http://wearebeatradio.tumblr.com/post/25646067876/maybe-the-reason-to-buy-music-is-just-because-it-feels